| DAS PENTAGRAMM |
|
Das Pentagramm, im Volksmund auch Drudenfuß genannt, ist ein fünfeckiger Stern mit gleich langen Linien und zugleich der einfachste, der in einem Zug gezeichnet werden kann ( von griech. pente = fünf und gr. grámma = Geschriebenes, Buchstabe, Schrift ). Die geometrischen Proportionen des Pentagrammes entsprechen dabei dem Goldenen Schnitt, welcher die Teilung einer Strecke in zwei Abschnitte, deren kleinerer sich zum größeren verhält, wie dieser zur ganzen Strecke, darstellt. Zeichnet man ein Pentagramm in einem Zuge, ohne abzusetzen und ordentlich geschlossen auf die Türschwelle, hält es Dämonen, den Alp, Teufel, Hexen und Druden fern. So konnte Mephisto in Goethes Faust in einem Pudel das Studierzimmer Fausts betreten, da das Pentagramm auf der Türschwelle nicht korrekt gezeichnet war ( "Der eine Winkel, der nach außen zu, Ist, wie du siehst, ein wenig offen." ), konnte die Stube - er muss durch dieselbe Tür hinaus -, aber erst verlassen, nachdem er eine Ratte den Drudenfuß annagen ließ. Als Hilfsmittel zur Beschwörung bei magischen Ritualen wird die Form mit der Spitze nach oben als weißmagisch, umgekehrt als schwarzmagisch bezeichnet.
Das Pentagramm kann offen oder von einem Kreis umschlossen sein. Als ein heidnisch-religiöses Symbol repräsentiert das offene P. eine offene, aktive Haltung, Bereitsein zum Konflikt. Ein umkreistes P. - die passive Form - bindet und beschützt; der Kreis meint hier Ewigkeit und Unendlichkeit, die Zyklen von Leben und Natur, so steht dieses P. bei den Rosenkreuzern für den wiedergeborenen, neuen Menschen.
In das Pentagramm kann, wie von Agrippa von Nettesheim, der "bewusste Mensch" gezeichnet werden. Dieses Bild symbolisiert den Menschen - den Mikrokosmos -, wie er dem Universum - dem Makrokosmos - spiegelbildlich entspricht; was in einem ist, muß in dem anderen enthalten sein ( hermetische Philosophie ). Die vier Elemente - Feuer, Wasser, Erde und Luft - mit der Quintessenz ( oder dem Äther ) über der oberen Spitze lassen sich ebenfalls um das Pentagramm gruppieren. So war es in den gnostisch-manichäischen Glaubensgruppen, deren heilige Zahl die 5 war, ein zentrales Sinnzeichen. Geschichte Das früheste ( bekannte ) Vorkommen des Pentagrammes datiert auf das vierte vorchristliche Jahrtausend bei den Chaldäern im alten Mesopotamien, wo man es auf Topfscherben gefunden hat. In späteren Perioden der mesopotamischen Kunst wurde das P. für königliche Inschriften verwendet und symbolisierte die sich in alle vier Richtungen der Welt ausstreckende, herrschaftliche Macht und das Himmelsgewölbe. "Entdeckt" wurde es möglicherweise in Zusammenhang mit astronomischen Forschungen, denn die Venus, für die das Zeichen in dieser Region auch stand, beschreibt im "Tierkreis" von der Erde aus gesehen die Form eines P.es. Ab ca. 2700 v. Chr. war es ein übliches Symbol bei den Sumerern.
Mit den Grundprinzipien der hermetischen Philosophie, in geheimen Gemeinschaften von Handwerkern und Gelehrten, abseits der Augen der Kirche und ihrer Paranoia, entwickelte sich die Proto-Wissenschaft der Alchemie samt ihrer okkulten Philosophie und kryptischem Symbolismus.
Bis zum neunzehnten Jahrhundert erschien keine graphische Abbildung, die das P. mit dem Bösen in Verbindung brachte. Erst Eliphaz Levi Zahed ( Alphonse Louis Constant ) stellt dem aufrecht stehenden P. des mikrokosmischen Menschen ein umgedrehtes P. mit dem Ziegenkopf Baphomets zur Seite. Es ist diese Illustration und Nebeneinanderstellung, die zum Konzept der unterschiedlichen Orientierungen des P.es hin zu "gut" und "böse" geführt hat. 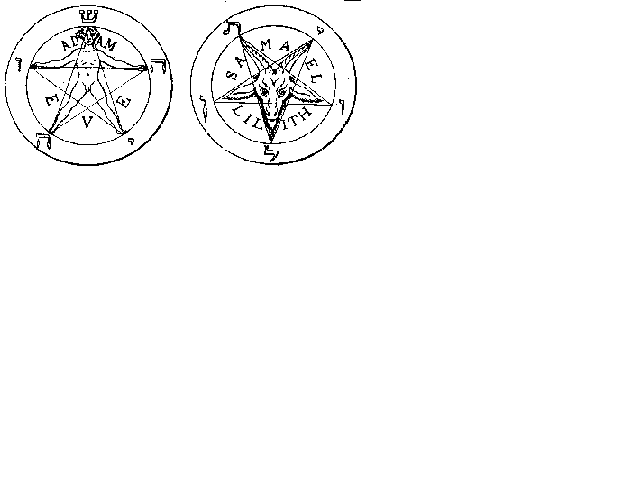 Gegen den Rationalismus des 18. Jahrhunderts erschien eine Reaktion im 19. Jahrhundert mit dem Wachsen eines neuen Mystizismus, der der Kabbalah, der alten mündlichen Weitergabe des Judaismus bezogen auf die Kosmogonie Gottes und des Universums und die moralischen und okkulten Wahrheiten von deren Beziehung zum Menschen, viel schuldete. Diese ist nicht so sehr eine Religion als ein System der Übereinkunft basierend auf Symbolismus und den numerischen und alphabetischen Wechselbeziehungen von Worten und Konzepten - die Gematria, d.h. der geheime Sinn einer Schrift erschließt sich u.a. durch die Zahlenwerte der Buchstaben. |
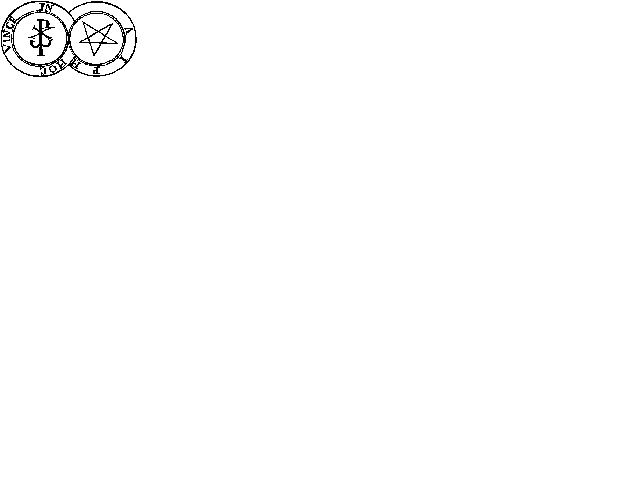 Bis zur Inquisition gab es keine "bösen" Assoziationen in Zusammenhang mit dem P. Es implizierte vielmehr Wahrheit, religiösen Mystizismus und das Werk des Schöpfers. Kaiser Konstantin I. nutzte das Symbol, nachdem er die Hilfe der christlichen Kirche bei seiner militärischen und religiösen Machtübernahme des Römischen Reiches im Jahre 312 erhalten hatte, zusammen mit dem Christus-Symbol ( chi-rho ) in seinem Siegel und Amulett:
Bis zur Inquisition gab es keine "bösen" Assoziationen in Zusammenhang mit dem P. Es implizierte vielmehr Wahrheit, religiösen Mystizismus und das Werk des Schöpfers. Kaiser Konstantin I. nutzte das Symbol, nachdem er die Hilfe der christlichen Kirche bei seiner militärischen und religiösen Machtübernahme des Römischen Reiches im Jahre 312 erhalten hatte, zusammen mit dem Christus-Symbol ( chi-rho ) in seinem Siegel und Amulett: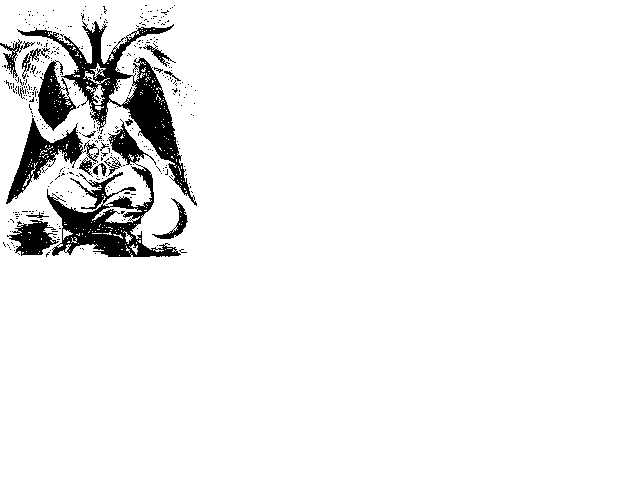 Während der mit vielen Lügen und Beschuldigungen im Interesse der Orthodoxie und Vernichtung der "Ketzerei" einhergehenden Inquisition fiel die Kirche in eine lange Periode, in der sie den Teufelskult zu bekämpfen suchte. Das hier inverse Pentagramm symbolisierte für sie den Teufel mit Ziegenkopf in Form des Baphomet, und es war Baphomet, wegen dessen Anbetung die Inquisition die Templer anklagte. Zu dieser Zeit wurden Hexen und andere gehörnte Götter wie Pan mit dem ( christlichen ) Teufel gleichgesetzt und das P. - das volkstümliche Symbol für Sicherheit - wurde erstmals in der Geschichte mit dem Begriff des Bösen belegt und Hexen- oder Drudenfuß genannt.
Während der mit vielen Lügen und Beschuldigungen im Interesse der Orthodoxie und Vernichtung der "Ketzerei" einhergehenden Inquisition fiel die Kirche in eine lange Periode, in der sie den Teufelskult zu bekämpfen suchte. Das hier inverse Pentagramm symbolisierte für sie den Teufel mit Ziegenkopf in Form des Baphomet, und es war Baphomet, wegen dessen Anbetung die Inquisition die Templer anklagte. Zu dieser Zeit wurden Hexen und andere gehörnte Götter wie Pan mit dem ( christlichen ) Teufel gleichgesetzt und das P. - das volkstümliche Symbol für Sicherheit - wurde erstmals in der Geschichte mit dem Begriff des Bösen belegt und Hexen- oder Drudenfuß genannt.